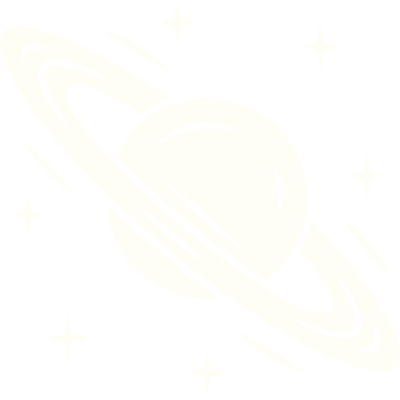- Sa/So 1./ 2.3., 14-18h WAA-Einführungskurs in die Astrofotografie (für WAA- und AV-Mitglieder 50€)
- Sa 1.3., 18h im Sterngarten: Planetenparade und Wintersechseck incl. Merkur (mit Franz Vrabec und Erika Erber)
- ab Fr 7.3., 10-11:45 Vorlesungsreihe Einführung in die Astronomie von G.Gerstbach (TU Wien, 6 freie Plätze für Mitglieder)
- Fr 7.3., 18-19:30 im Sterngarten: Kinderführung ”Wo treibt sich überall der Mond herum?” mit Gottfried Gerstbach und Jürgen Schwingshandl. Eventueller Ersatztermin am 14. März
- Mi 12.3. oder 19.3., 19h Café Raimann: 22. ASTA – Astronomischer Stammtisch mit Franz Vrabec
- Mo 17.3., 19:30 Online: Doppelsichtbarkeit der Venus und Vorschau auf Sonnenfinsternis 29.3., mit Alex Pikhard
- Sa 22.3., 14-18h Online: Atmosphärische Zirkulation und Klimazonen (Andres Pfoser), erster von 5 Kurstagen, 10 €
- So 23.3., 11:30 Frühlingsbeginn im Sterngarten (mit Caroline Posch-Primes und Franz Vrabec)
- Sa 29.3., 11:30 im Sterngarten: Partielle Sonnenfinsternis , mit Christian Maurer et al.
- Im griechischen Mythos ist es die Nymphe Kallisto, eine Geliebte des Zeus, die er vor dem Zorn seiner Gattin Hera in eine Bärin verwandelte und an den Himmel versetzte. Ihr kleiner Sohn Arkas wurde zum Kleinen Bären (UMi) mit Alfa als Polarstern.
- Bei den Römern und schon vorher in Persien hießen die 7 Wagensterne Septemtriones (sieben Dreschochsen), weil sie ständig um den Pol wandern. Ihr Antreiber ist das Sternbild Bootes (Ochsentreiber, auch Bärenhüter), zu dessen rötlichem Hauptstern Arktur der Schwung der Deichsel zeigt.
- In Arabien hieß das Sternbild Banat-Na-asch (heute η UMa = Benetnasch), die Töchter an der Totenbahre. Die Kastensterne α, β, γ, δ waren ein Sarg, dem die Klageweiber, drei Schwestern, weinend folgen.
- Für die Indianer Nordamerikas waren hingegen die Kastensterne der Grizzlybär, dem drei Jäger (ε, ζ, η) folgten. Der mittlere Jäger trägt einen Kochtopf, den freiäugigen Doppelstern Alkor bei Mizar.. Er dient gerne als ”Augenprüfer” und heißt auch Reiterlein, weil er quasi auf der Wagendeichsel reitet.
- Im nordischen Sagenkreis stand er für den Sturmwagen Wotans. Im alten Mexiko war es jedoch ein einbeiniger Riese – wie er ja tatsächlich bei seinem hochsteigen im Frühjahr aussieht.
- In China war der Wagen die Sänfte, die der am Polarstern residierende Jadekaiser für Inspektionsreisen zur Erde bestieg. Heute heißt er bei den Chinesen auch Nördlicher Schöpflöffel –
- ähnlich wie der Big Dipper im Anglo-amerikanischen Sprachraum.
- Im Christlichen Himmelsatlas von Julius Schiller (1627) wurde der Große Bär zum Fischerboot des Hl. Petrus.
- 1857 erste Fotografie eines Doppelsterns (Mizar und Alkor) – heute als Sechsfach-System bekannt
- 1979 erste eindeutige Gravitationslinse vor dem ”Zwillingsquasar” QSO09057+561
- 1995 10 Tage belichtetes Hubble Deep Field einer scheinbar leeren Stelle, aber 3000 ferne Galaxien. Folgebeobachtungen zeigen 2016 die bisher jüngste Galaxie in 13,4 Mrd. Lichtjahren
- 1996 erster Exoplanet mit langer Umlaufzeit (3 Jahre) beim sonnenähnlichen Stern 47 UMa; 2010 zwei weitere Planeten
- 2014 SN2014J in der Starburst-Galaxie M82; mit nur 12 Mill.L Lichtjahren die nächstgelegene Supernova seit Jahrzehnten.
Im März wächst der helle Tag besonders deutlich: von 11,0 auf 12,8 Stunden. Der Sonnenaufgang in Wien verschiebt sich von 6:35 auf 5:35 MEZ, der Sonnenuntergang von 17:39 auf 18:23 Uhr. Im Westen Österreichs sind die Auf- und Untergänge je nach geografischer Länge später, in Innsbruck z.B. um 20 Minuten.
Völlig dunkel ist es um etwa 19:30 Uhr, gegen Monatsende um 21h (MESZ); die tiefe Nacht währt nur mehr 9 Stunden. Die bürgerliche Dämmerung (Sonnentiefe 6°, Lesen im Freien möglich) dauert wegen der nun steil liegenden Ekliptik nur 29 Minuten, die nautische (-12°, am Meer sind Horizont und helle Sterne sichtbar) weitere 36 Minuten. In der anschließenden astronomischen Dämmerung (Sonne -12 bis -18°) wird der Himmel völlig dunkel — allerdings nur fern der städtischen Lichtglocken.
Nicht nur die Länge von Tag und Nacht hängt von der Jahreszeit ab, sondern auch wie lange Sonnenuntergang und die Dämmerung dauern (siehe Sterngarten-Führung am 23.März). Weil sich diese und andere Phänomene im Sterngarten gut demonstrieren lassen, nannte Hermann Mucke die 1998 errichtete Anlage auch „Freiluftplanetarium“.
Planeten und Mond (siehe Österr. Astronomischer Almanach 2025)
Den Abendhimmel dominieren zunächst weiterhin vier helle Planeten, wobei im Südwesten der flinke Merkur ab 25.2. Saturns Stelle einnahm. Hoch im Süden stehen Jupiter und Mars, Venus wechselt zur Monatsmitte auf den Morgenhimmel.
- Merkur tauchte ab 25.2. in der Abenddämmerung auf (Untergang 70 min nach der Sonne) und erreicht am 8.3. seinen maximalen Sonnenabstand von 18°, wo er am 9.3. der Venus begegnen wird. Am besten ist Merkur vom 5.-11.3. zu beobachten, wo er 30 min nach Sonnenuntergang etwa 7° über dem Westpunkt des Horizonts steht.
- Venus verabschiedet sich vom Abendhimmel. Anfangs geht sie 3 Stunden nach der Sonne unter, zur Monatsmitte 1,2 Stunden. Gleichzeitig geht sie 30 min vor der Sonne auf. Diese seltene „Doppelsichtbarkeit” der Venus (Deklination +10° gegenüber -2° der Sonne) hängt mit ihrer 7° zur Ekliptik geneigten Bahn zusammen, wegen der auch Venusdurchgänge so selten sind.
- Die Elongation (Winkelabstand zur Sonne) wechselt von 31° Ost auf 14° West, die Größe ihrer heuer gut sichtbaren Sichelgestalt nimmt von 50” auf beachtliche 60” zu. Vom 1.-2.3. zieht der Mond 6° südlich an Venus vorbei.
- Am 11.3. bedeckt die Venus den 9.4 mag-Stern UCAC4 505-00503 (9.4 mag) von 18:57 bis 19:50. Erfahrenen Beobachtern im Westen könnte der Austritt an der dunklen Venusseite gelingen (in Wien Beginn bei nur 8° Höhe)
- Mars in den Zwillingen stand am 16.1. in Opposition und kulminiert daher nun schon 4–5 Stunden vor Mitternacht. Er hat seine heurige Schleife beendet und zieht die nächsten Wochen wieder langsam nach links. Mit wachsender Entfernung schrumpft sein Scheibchen von 11” auf 8″, sodass Details nur mehr im größeren Teleskop zu sehen sind. Freiäugig ist hingegen seine fast stationäre Lage zu Castor/Pollux reizvoll, die der Mond am 8./9. fast in der Mitte durchquert.
- Jupiter im Stier steht hoch im Südwesten (11° über Aldebaran) und ist schon länger rechtläufig. Abends steht er hoch im Südosten und sein Scheibchen misst noch 43 bis 40”. Am 6./7.2. steht der Mond in der Nähe.
- Weiterhin reizvoll ist das Spiel seiner Monde. Noch je 10 mal gibt es ihre Durchgänge und Schattenwürfe auf Jupiters Wolkenhülle, davon 9 schon vor Mitternacht, außerdem 8 Verfinsterungen (AAÖ Seite 53).
- Saturn im Wassermann verschwand Ende Februar in der Abenddämmerung. Der Durchgang der Erde durch die Ringebene ist Ende März, aber leider unsichtbar. Konnte jemand die Schattentransits durch Titan am 8. und 24.2. beobachten? Das wäre vielleicht einen kurzen Beitrags in der Homepage wert.
- Uranus wandert vom Widder zum Stier. Sein grünliches Scheibchen von 3,4” ist schon im kleinen Teleskop von Sternen zu unterscheiden, im Feldstecher mit 6 mag immerhin zu finden. Jupiter ließ ihn seit der Konjunktion 2024 schon 20° hinter sich.
- Neptun steht jenseits der Sonne und bis Juni unsichtbar.
- Kleinplaneten: Vesta in der Waage nähert sich ihrer Opposition und ist bereits heller als Uranus. Juno steht in der Schlange.
Konjunktionen (aus ”Himmelsjahr” und AAÖ)
- 01.3., 05h: Mond 0,5° südlich von Merkur (nicht beobachtbar)
- 02.3., 00h: Mond 6° südlich von Venus
- 05.3., 05h: Mond 4,8° nördlich von Uranus
- 06.3., 13h: Mond 5,6° nördlich von Jupiter
- 08.3., 07h: Merkur in größter östlicher Elongation (18°)
- 09.3., 01h: Mond 1,7° nördlich von Mars; um 3h Abstand 0,9°
- 09.3., 12h: Merkur 6,4° südlich von Venus; abends Abstand 5,5°
- 11.3., 18:57-19:50 bedeckt die Venus einen Stern 9.4 mag (siehe oben), im Westen Österreichs möglich
- 12.3., 11h: Saturn in Konjunktion mit der Sonne
- 14.3., 7:26–8:32: Totale Mondfinsternis, in Europa nur Beginn sichtbar (Monduntergang Wien 6:15 MEZ)
- 20.3., 10h: Sonne im Frühlingspunkt, Tag-und-Nacht-Gleiche (im Sterngarten 23.3.)
- 23.3., 02h: Venus untere Konjunktion mit der Sonne
- 23.3., 19h: Erde wechselt von Nord- auf Südseite der Saturnring-Ebene
- 28.3., 03h: Merkur 4,2° nördlich von Neptun
- 28.3., 13h: Mond 1,8° nördlich von Saturn
- 28.3., 16-22h: Mond 8,5° südlich von Venus
- 28.3., 22-23h: Mond 3° südlich von Merkur / 1,7° nördlich von Neptun
- 29.3., 12h: partielle Sonnenfinsternis (in Wien 6,3%, Innsbruck 10,1%) –> Sterngarten ab 11h45
- 30.3., 07h: Venus 10° nördlich von Saturn (nicht beobachtbar)